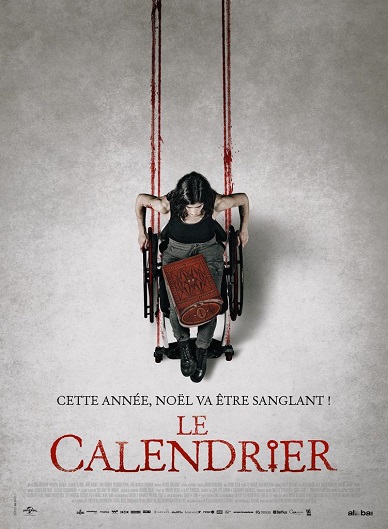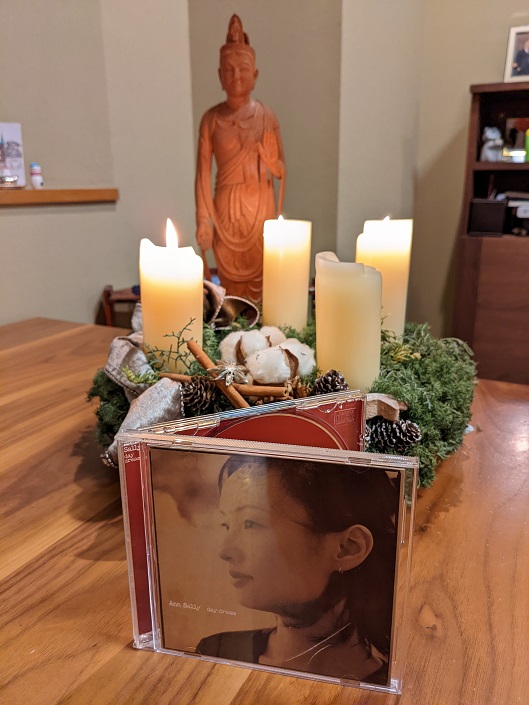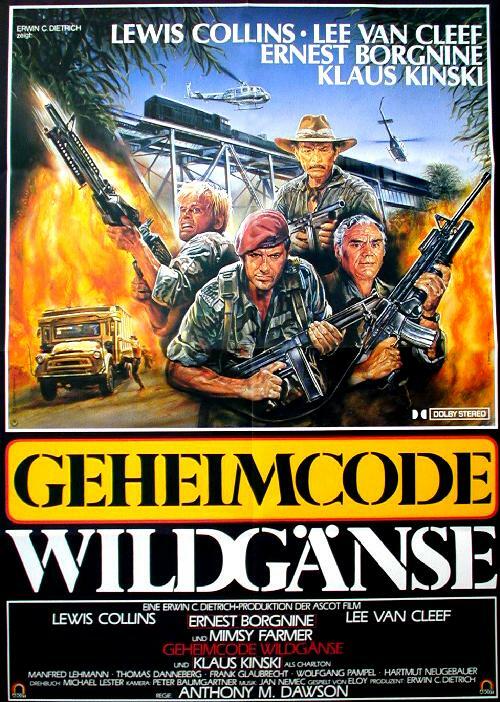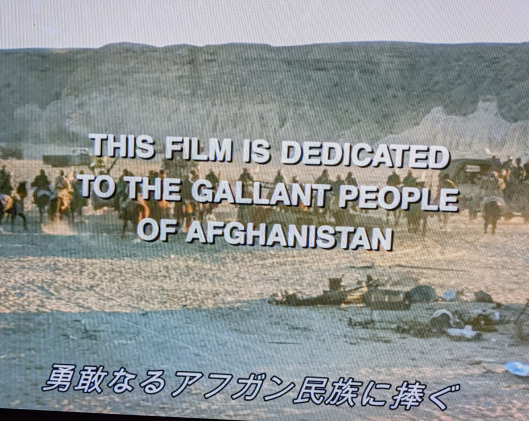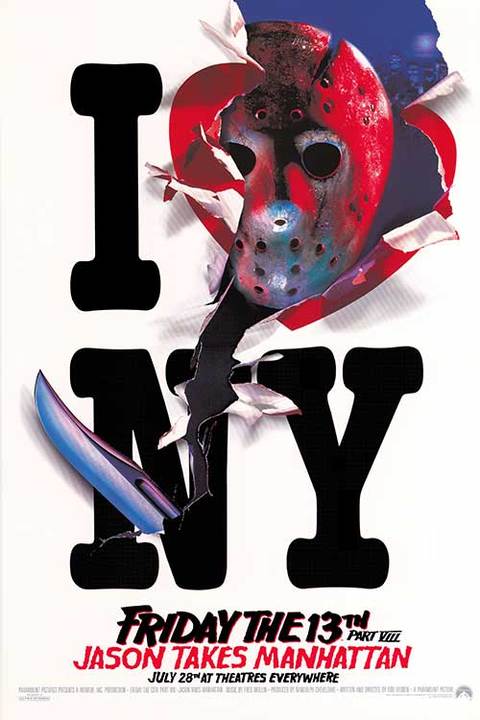Ich wollte nur klarstellen, dass es hier um Weihnachtsfilme geht, denn meinen letzten Beitrag zum Thema hatte ich unter einer Überschrift versteckt, die unter SEO-Gesichtspunkten nicht super-duper optimal komponiert war.
Es ist eine schöne Tradition in diesem Blog, über die Weihnachtsfilme zu schreiben, die ich in dieser Saison gesehen habe, weil mir sonst nichts einfällt (jetzt schon im zweiten Jahr). Vorweg: Ich habe nicht vor, die Handlungen der Filme wiederzugeben, nicht mal ein bisschen. Nicht weil ich plötzlich an Spoiler glauben würde, sondern erstens weil der Plot als Qualitätsmerkmal von Erzählungen generell überbewertet wird, zweitens weil es im modernen Weihnachtsfilm ohnehin nur zwei verschiedene Plots gibt (also fünf weniger als insgesamt auf der Welt, wenn man Creative-Writing-Klugscheißern glauben möchte):- 1. Jemand bringt besten Freund/beste Freundin (wahlweise eine/n völlig Fremde/n) mit zum familiären Weihnachtsfest, um ihn oder sie als die aktuelle ernsthafte Beziehung auszugeben. Zum Schluss ist es dann wirklich so.
- 2. Eine eiskalte Geschäftsfrau (seltener Geschäftsmann) wird von der großen Stadt (gerne „L. A.“) aufs Land geschickt, um dort irgendetwas gegen den Willen der Landbevölkerung zu gentrifizieren. Zum Schluss, nach einigen Witzen über Kuhfladen und Kalbsgeburten, lässt sie sich auf dem ungentrifizierten Land häuslich nieder, und zwar mit einem gutaussehenden, breitschultrigen Typen vom Land, den sie zuerst gar nicht abkonnte.
Beginnen wir mit dem stärksten Tobak, damit wir es hinter uns haben: Lindsay Lohan in Falling for Christmas. Zu behaupten, der Netflix-Film habe gute Kritiken bekommen, wäre stark übertrieben; er hat überwiegend negative erhalten. Gleichwohl durchwehte viele ein Tenor von: „Nicht ganz so katastrophal wie erwartet, und la Lohan ist sogar richtig gut.“
Ich bin darauf reingefallen. Deshalb ist es mir umso wichtiger, dass nachfolgende Generationen nicht denselben Fehler machen wie ich, und ich sage ohne weihnachtliche Güte: „Doch! Der Film ist haargenau so katastrophal, wie man nach dem scheußlichen Trailer erwarten durfte, und Lindsay Lohan ist komplett fehlbesetzt!“ Lindsay Lohan ist eine Frau mit einer gewissen Lebenserfahrung (die Presse berichtete und berichtete und berichtete), und die steht ihr ins Gesicht geschrieben. Das zickige, naive kleine Mädchen, das noch an Daddys Rockzipfel hängt, kann sie damit nicht mehr spielen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Dieser talentierten Schauspielerin ist ein Comeback zu gönnen, und wenn dieser Film das Weihnachtswunder vollbringt, dann meinetwegen. Aber von Herzen hätte ich ihr einen anderen, richtigen Film gewünscht, mit einer echten Rolle für eine erwachsene Frau. In einer Weihnachtsfilmdisziplin immerhin ist Falling for Christmas überdurchschnittlich: Es gibt nicht nur eine tote Mutter, sondern gleich zwei. Da in diesem Jahr wirklich kein einziger Weihnachtsfilm ohne tote Mutter auskommt, habe ich mir mal Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Hier ist das Ergebnis: Vielleicht liegt es daran, dass tote Mütter viel schlimmer sind als tote Väter. Und alleinerziehende Väter viel lustiger und rührender als alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende Mütter sind vermutlich zu realistisch, das zieht die Stimmung total runter. In Something from Tiffany’s gibt es, wenn ich mich nicht verzählt habe, nur eine tote Mutter. Gegen Falling for Christmas nimmt sich der Film aus wie ein Spike Lee Joint, written and directed by Woody Allen, a Martin Scorsese picture. Für sich betrachtet ist Something for Tiffany’s aber nur das, was ich von Falling for Christmas erhofft hatte: Ein Film, der nicht wehtut. Eine romantische Komödie ohne richtige Witze und allzu dramatische Konflikte. Man könnte ihn also als ‚recht erwachsen‘ bezeichnen, wie man immer alles als ‚erwachsen‘ bezeichnet, wenn man nicht ‚langweilig‘ sagen möchte. Dieser Trend hat nach meiner Beobachtung bei Quentin Tarantinos Jackie Brown angefangen und wird möglicherweise bei Star Wars‘ Andor nicht enden. Ist also wahrscheinlich gar kein Trend, sondern das neue Normal. ‚Ein bisschen langweilig‘ heißt jetzt ‚sehr erwachsen‘. Bemerkenswert an diesem Weihnachtsfilm ist, dass es eigentlich gar keiner sein müsste. Ein vertauschtes Geschenk stößt zwar den Plot an, doch die Menschen schenken schließlich nicht zu Weihnachten allein. Die Hauptfigur weißt sogar darauf hin, dass sie Jüdin ist. Erst ganz zum Schluss, als schnell noch angetackerten Epilog, gibt es eine explizite Weihnachtsszene, die aber für den Gesamtzusammenhang irrelevant ist. Ich möchte jedoch gar nicht meckern. Als Erwachsener, dem richtige Filme oft zu aufregend sind, war mir diese Amazon-Produktion ganz sympathisch. Sprechen wir vorübergehend nicht über Weihnachtsfilme, sondern über Weihnachtsfernsehserien (Scheibenkleister, Überschrift vielleicht doch nicht optimal). Ich war gegen The Santa Clauses auf Disney+, aber meine Frau war dafür, und man weiß ja, wie sowas endet. Bunt war es. So bunt, dass wir aus Versehen die ganze Serie gesehen haben, und nun wurde eine zweite Staffel bewilligt, und wir tragen eine Mitschuld. Das Ganze ist eine Fortsetzung der Santa-Clause-Filme mit Tim Allen, von denen ich keinen gesehen habe, weil ich über Tim Allen noch nie lachen konnte (ich habe es auch diesmal nicht gelernt). Das wiederum liegt nicht daran, dass wir auf unterschiedlichen Seiten des politischen Stammtisches sitzen, wenn wir nicht gerade Weihnachtsstimmung verbreiten. Über einen Stammtisch kann ich hinwegsehen, so viel Größe habe ich. So viel Größe hat wohl auch Kal Penn (178 cm laut Google), der hier eine Art etwas sympathischeren und viel erfolgloseren Jeff Bezos spielt (Mann von toter Mutter), was er wie gewohnt gut macht, was aber in dem kunterbunten, witzlosen, immerhin auf irgendeine magische Weise die Zeit vertreibenden Irrsinn auch nicht viel reißen kann. Marvels The Guardians of the Galaxy Holiday Special über die Entführung des Schauspielers Kevin Bacon (der Schauspieler Kevin Bacon) durch außerirdische Superhelden ist so lustig, wie es klingt (also ziemlich).Dennoch nur ein schwacher Ersatz für die goldige letztjährige Marvel-Weihnachtsserie Hawkeye, die ich mir in diesem Jahr einfach noch mal angesehen habe, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Hat wieder funktioniert. Und so ist Hawkeye nun nach Only Murders in the Building die zweite Serie des Streaming-Zeitalters, die ich mir zweimal komplett angesehen habe, und zwar beide Male mit außerordentlichem Vergnügen. Dass beide auf Disney+ laufen, heißt vielleicht irgendwas. Ich weiß nicht genau was, aber bestimmt nichts Gutes für Netflix. (Die dritte Zweimal-Serie wird gerade The Peripheral. Auch nicht Netflix.) Marvel hat in diesem Jahr mit Moon Knight und She-Hulk: Attorney at Law bewiesen, dass doch noch ein bisschen Saft im alten Marvel-Zitroniversum ist. Hawkeye allerdings bleibt die vorderste Marvel-Vorzeigeproduktion. Gelegentliche Selbstironie statt ständiger Metaebene, richtige Menschen als Super-Protagonisten, New Yorker Lichterglanz, Weihnachtslieder und auch sonst genau das richtige Maß an Parampampampam. Widerwillig zurück zum Film. Sollte ich eingangs behauptet haben (und das habe ich), dass Falling for Christmas der größte Tobak in diesem Beitrag sei, dann nur, weil ich I Believe in Santa zwischenzeitlich schon wieder verdrängt hatte. Jetzt jedoch kommt er wieder hoch. Es handelt sich um die Liebesgeschichte zwischen einer erwachsenen Journalistin, die Weihnachten hasst, weil sie als Kind einmal nicht ihre Barbie-Puppe bekommen hatte, und einem erwachsenen Anwalt, der noch an den Weihnachtsmann glaubt, weil … tut er halt. Gemacht wurde dieser lieblos dahingeschluderte Murks derweil ausschließlich von Menschen, die Weihnachten hassen. Und Filme. Und Fernsehen. Eigentlich alles, außer pünktlich Feierabend machen. Was für eine visuelle Wohltat da Your Christmas or Mine?. Dieser Film sieht aus, als wäre er von Leuten gemacht, denen es nicht egal ist, wie so ein Film aussieht. Obendrein ist der Plot eine erstaunlich originelle Variation des Familientreffen-Themas und die Besetzung äußerst sympathisch. Hilft natürlich alles nichts, wenn das Skript vorgestern hätte fertig sein müssen und man knapp vor Drehbeginn schnell die erstbeste Version von allem runtertippt, was noch nicht getippt wurde. So bleibt dann doch nur in Erinnerung, wie schön die Schneeflocken purzelten. Das immerhin ist in dieser Weihnachtsfilmsaison nicht nichts. Zuletzt schnell vorgespult ein paar Titel, die ich nicht oder nicht ganz geschafft habe. Es gibt da einen Film, in dem Freddie Prinze Jr. den Witwer-Vater spielt. Das Überraschende daran ist, dass das nicht der Film mit Lindsay Lohan ist. Wir waren bereits zu desillusioniert, um an ein verborgenes Juwel zu glauben. Nach dem Trailer von The Hip Hop Nutcracker sagte meine Frau: „Ich verstehe immer noch nicht, was das ist.“ Dabei steht sie der Welt des Hip-Hop näher als ich, und ich stehe ihr auch nicht völlig fern. Stellt sich heraus: Erst wird ein bisschen gerappt, dann ein bisschen Tschaikowsky gescratcht, schließlich viel getanzt. Wir haben uns nach 10 von 40 Minuten entschlossen, dass wir das respektieren können, aber nicht sehen möchten. Halb habe ich den satirischen No-Budget-Weihnachts-Home-Invasion-Thriller The Leech auf Arrow Player gesehen, und die zweite Hälfte schaffe ich vielleicht auch noch. Aber erst nach Weihnachten. Erinnerte mich ein bisschen an einen anderen Film, dessen Titel ich leider vergessen habe. Sie wissen schon, welchen ich meine. Hat mit Something from Tiffany’s (s. o.) nicht per se viel gemein, scheint allerdings auf den ersten halben Eindruck ebenfalls einer dieser Weihnachtsfilme zu sein, die eher zufällig an Weihnachten spielen. Und damit verabschiede ich mich ins richtige Weihnachtsfest und wünsche uns allen bessere Weihnachtsfilme im nächsten Jahr. Das ist zugegebenermaßen keine allzu hoch gehangene Zuckerstangenmesslatte.