










Zwei Leuchtbuchstaben kaputt. Unfall oder mutwillig herbeigeführt? Entscheiden Sie.


Liebes Blög,
ich bin in Taiwan, und hier ist alles so fremd. Überall sind eigentümliche Schriftzeichen, besonders häufig sehe ich das sogenannte Ö. Der Fernseher in meinem Hotelzimmer ist von dieser Marke:



11 Jahre habe ich gebettelt, dass mich mal einer mitnimmt, aber ich kenne nur zu feine Pinkel. Dachte ich. Der einzige japanische Mensch, den ich prinzipiell nicht gefragt hatte, war ausgerechnet Schwester M. Weil ich meinte: Die singt ja sowieso, da ist Karaoke bestimmt unter ihrem Niveau. Stellt sich aber heraus: Jeder muss mal üben. Als sie selbst das Gespräch auf das Thema bringt, frage ich kleinlaut, ob sie mich mal mitnimmt. Sagt sie: „Okay, gehen wir!“
So habe ich freilich nicht gewettet. Ich meinte: Irgendwann mal, abends, wenn ich beschwipst bin und mich ganz toll finde. Nicht bei Tageslicht, nüchtern, kurz nach dem Mittagessen. Aber ich habe keine Wahl. Megumi hat in einer Stunde Vorstellungsgespräch. Es wäre ja gelacht und sie keine echte Japanerin, wenn da nicht noch Platz für eine halbe Stunde Karaoke wäre. Möglicherweise ist es nicht das erste Mal, dass ich überhaupt Karaoke singe. Könnte sein, dass da mal was auf einer Party in Bremen war. Aber ich habe an den betreffenden Abend keine klare Erinnerung, und die Oral History widerspricht sich von Historiker zu Historiker. Außerdem ist Karaoke in Japan eh anders. Man blamiert sich nicht vor einer Meute Wildfremder bis auf die Knochen, sondern, in meinem Fall, vor nur einer Person, die man schon locker eineinhalbmal im Leben gesehen hat. Karaoke findet in Privatkabinen statt, die auf Zeit gemietet werden. Nach westlichem Moralkodex, vielleicht auch nur nach meinem eigenen, haben Vergnügungen in schalldichten Privatkabinen, die im Halbstundentakt abgerechnet werden, grundsätzlich etwas Verdorbenes. Während wir durch die zugleich schummrigen und sterilen Korridore des Karaoke-Zentrums auf der Suche nach unserer Zelle schleichen, muss ich schwer an mich halten, um nicht ins Telefon zu rufen: Ehrlich, Mama, wir machen nur Hausaufgaben! Unsere Kabine beinhaltet ein schmutzabweisendes Sofa, einen Couchtisch mit Musikkatalogen und Speisekarten, mehrere Lautsprecher, eine Klimaanlage und selbstverständlich eine Karaoke-Maschine + großem Fernseher, auf dem Fernseh-Menschen quiekend neue Produkte anpreisen, wenn gerade kein echter Mensch singt. Zwei Mikrofone und ein Fernbedienungspult haben wir in einem Körbchen, das uns am Empfang überreicht worden war, selbst mitgebracht. Megumi stellt es auf einmal so dar, als sei das Ganze meine Idee gewesen, deshalb soll ich anfangen. Ich bin nicht mal halb durch Bullet With Butterfly Wings

Nach meiner furchtlosen Visite des Yasukuni-Schreins gehe ich heute wieder hin, wo es wehtut (wenn auch nicht so weh, als würde ich dabei einen Mikoshi tragen). Der Miyashita-Park ist ebenfalls ein Politikum, wenn auch eines, bei dem die Weltpolitik mit den Schultern zuckt. In Tokio aber wird durchaus kontrovers diskutiert.
In den Miyashita-Park gerät man als Tourist nur, wenn man zu Tower Records will und im Bahnhof Shibuya den falschen Ausgang erwischt hat. Der Park ist auf Karten in Reiseführern der Vollständigkeit halber eingezeichnet, wird aber im Text sicherlich keine Erwähnung finden. Mit Sicherheit steht hingegen in jedem Reiseführer der Hinweis, dass man sich in dieser Stadt selbst als Frau immer und überall ohne Leibgarde frei bewegen kann. Fragt man Tokioterinnen nach der Richtigkeit dieser Einschätzung, pflichten sie im Großen und Ganzen bei. Hängen aber oft noch an: „Außer vielleicht im Miyashita-Park.“ Es handelt sich um einen schmalen, leidlich grünen Streifen zwischen Eisenbahnschienen und Meiji-dori. Ein öffentlicher Park, er gehört also den Bürgern, und die Bürger haben ihn seit Jahrzehnten aufgegeben. Man erinnert sich allenfalls an ihn, wenn man Sperrmüll hat und die Gebühren sparen möchte. Jetzt hat der Sportartikelhersteller Nike für einen zunächst begrenzten Zeitraum den Park gekauft. Die Firma will dort renovieren und Gratis-Skatergedöns errichten. Außerdem hat Nike für die vereinbarte Zeit das Recht, den Park nach eigenem Gutdünken umzutaufen. Es gilt also als sicher, dass der Miyashita-Park bald Nike-Park heißen wird. Könnte einen als Skater freuen. Könnte allen anderen Menschen völlig egal sein, wie einem der Park schon immer völlig egal war. Dennoch regt sich jetzt Protest. Wir sind das Volk, und der Park gehört uns, meinen ein paar Aktivisten, die ohne gute Argumente viel Presse bekommen.


Bei lokalen shintoistischen Straßenfesten ist es Brauchtum, mit großem Hallo und vereinten Kräften Schreine durch die Straßen zu tragen. In Nachbarschaften, in denen Ausländer oder ausländerfreundliche Organisationen beheimatet sind, dürfen auch Ausländer mittragen, was diese offenbar gerne tun. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich spontan: Wow – das interessiert mich null. Zuschauen ja, wenn ich in der Gegend bin und es Getränkeverkauf gibt, aber bestimmt nicht aktiv mitschleppen.
Als aber unlängst die Agentur, die mir meine Tokioter Wohnung vermietet, rumfragte, wer denn gerne den Agenturschrein beim Misaki-Festival im Stadtteil Jimbocho mittragen möchte, reckte ich sofort den Arm in die Höhe und rief: „ICH, ICH, ICH!“ Dabei hatte sich meine Einstellung gar nicht großartig geändert. Aber da war der nuttige Gedanke: Ich mach das, damit meine


Ramen Square NY. Warum wirbt ein japanisches Gastronomie-Erlebniszentrum, das sich auf chinesische Nudelsuppen spezialisiert, mit New York im Namen? Das einzige, was mich daran wundert, ist, dass es mich gar nicht mehr wundert. Alles, was ich weiß und wissen muss: Befindet sich in Tachikawa, westlich der Stadt Tokio, innerhalb der Präfektur Tokio, erreichbar über einen Laufsteg direkt vom örtlichen Bahnhof. Etliche Ramen-Blogger haben schon darüber gebloggt.
Bin ich hier etwa auch wegen der Nudeln rausgefahren? Nein, Nudeln gibt’s auch in Tokio, ich bin hier wegen der Musik. (Die Nudeln sind allerdings auch ganz gut, nur als Pescetarier muss man ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken, und als noch schlimmerer Tarier alle beide, oder eben Magen knurrt während des Konzerts.)




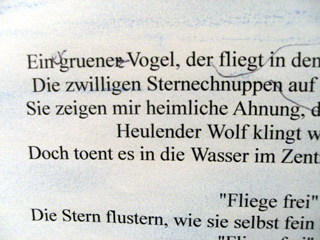





Offenbar ist dieser Film gerade in Hongkong sehr beliebt:

